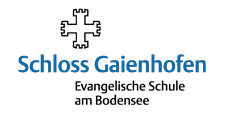„Stroherne Epistel!“ vs. „Billige Gnade!“
Mittwochsandacht_online
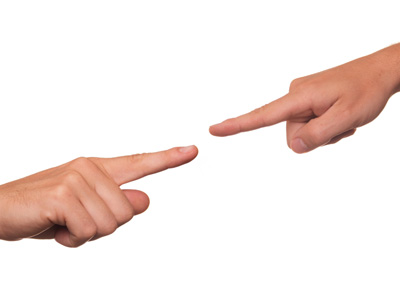
Quelle: pixabay (Tumiso)
Der Predigttext für den vergangenen Sonntag war ein Abschnitt aus dem Jakobusbrief. Darin schreibt Jakobus, dass ein Glaube ohne Werke nutzlos sei und nicht selig machen könne. Sollte jemand von Euch in Religion gut aufgepasst haben, wird ihn diese Aussage möglicherweise verwundern. Sagt nicht Luther genau das Gegenteil?
In der Tat konnte Luther mit dem Jakobusbrief nicht viel anfangen. In seiner Vorrede zum Neuen Testament nennt er ihn eine „recht stroherne Epistel“ – also ein strohtrockenes Schriftstück. Und er zieht in Zweifel, dass man den Jakobusbrief zu den apostolischen Schriften rechnen solle, weil er der Lehre des Paulus widerspreche und in ihm zu wenig von Christus die Rede sei. Immerhin ging Luther nicht so weit, den Jakobusbrief aus dem Kanon der Heiligen Schriften zu streichen. Er beließ ihn als Teil der Bibel, aber er klammerte ihn gewissermaßen ein.
Luther seinerseits wurde von Theologen der Gegenreformation vorgeworfen, dass er mit seiner Lehre von der Rechtfertigung allein aus Glauben die Moral untergrabe. Nun könnte man versucht sein zu sagen: „Naja, die Katholiken halt!“ Aber gut 400 Jahre später verwarf der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer die Verkündigung einer „billigen Gnade“. Damit meinte er eine Lehre, die jeden Menschen gerecht spreche, egal wie er sich verhalte, wenn er nur an Christus glaube. Und Bonhoeffer ist in der evangelischen Kirche ja nicht irgendwer. Wer hat nun Recht? Jakobus oder Paulus? Bonhoeffer oder Luther?
Die Sache wird zusätzlich kompliziert, wenn man zur Kenntnis nimmt, dass Jakobus und Paulus sich bei ihren einander widersprechenden Aussagen auf dieselbe Stelle der Hebräischen Bibel beziehen. Beide zitieren Gen 15,6: „Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden“.
Paulus schreibt im Römerbrief: „Ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? »Abraham hat Gott geglaubt, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet.« Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern weil er ihm zusteht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, aber an den glaubt, der den Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit.“ (Röm 4,2-4) Für Paulus ist der entscheidende Punkt an dieser Stelle, dass Menschen, die sich ihre Gerechtigkeit vor Gott durch Werke verdienen wollen, nicht auf die Gnade Gottes vertrauen.
Darüber hinaus ist der Versuch, sich die Gerechtigkeit durch Werke zu verdienen, aus Sicht von Paulus aussichtslos. Denn dazu wäre es notwendig, ausnahmslos alle Gesetze der Tora zu befolgen und dazu ist kein Mensch in der Lage. Mit Ausnahme von Jesus selbst. Die Argumentation finde ich schlüssig und sie wird von Luther praktisch eins zu eins übernommen.
Aber auch die Argumentation des Jakobus hat einiges für sich. Er schreibt: „Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen: Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch!, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat – was hilft ihnen das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber.“ Das finde ich ziemlich überzeugend.
Mit Blick auf Abraham fährt er fort: „Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken, und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht: »Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden«“ Den Verweis auf die Opferung Isaaks finde ich zwar problematisch, aber Jakobus hätte auch anführen können, dass Abraham im Vertrauen auf Gott seine gesicherte Existenz aufgegeben und sich auf den Weg in ein unbekanntes Land gemacht hat.
Also nochmal: Wer hat nun Recht? Paulus oder Jakobus? Vielleicht ist der Widerspruch nicht so groß, wie er auf den ersten Blick scheint – und wie Luther ihn wahrgenommen hat. Es kommt darauf an, was ich unter Glauben verstehe. Glaube ist mehr als ein Etikett, das ich mir aufklebe: „Seht her (oder: Gott, sieh her): Ich bin ein gläubiger Christ“. Glaube meint eine Beziehung, ein Vertrauen auf Gott, ein sich Gründen in Gott. Wenn ich mich so auf Gott einlasse, kann mir sein Wille, können mir seine Gebote nicht gleichgültig sein. Darin hat Jakobus Recht.
Die Werke sind für sich genommen nicht heilsnotwendig. Darauf bestehen Paulus und Luther zu Recht. Aber die Werke können ein Ausdruck dafür sein, wie ernst es mir mit meinem Glauben ist. Pfarrer*innen (besonders die evangelischen – mich eingeschlossen) stehen manchmal in der Gefahr, einen Wohlfühlglauben zu predigen, der jegliche Herausforderung vermissen lässt. Aber es ist nicht in Ordnung, buchstäblich alles abzusegnen, solange ein Mensch sich als gläubiger Christ versteht. Es gibt Haltungen und Verhaltensweisen, die sind mit dem christlichen Glauben schlicht unvereinbar. Jede Form der Menschenverachtung gehört aus meiner Sicht da dazu.
Also: Raus aus der Komfortzone! Engagement ist gefragt. Für Gott und für die Mitmenschen. Im Privaten, an der Schule und in der Gesellschaft. Auch auf die Gefahr des Scheiterns hin. Sogar auf die Gefahr hin, schuldig zu werden. Aber immer im Vertrauen darauf, dass Gott bereit ist, uns unsere Fehler zu verzeihen, wenn sie uns passiert sind bei dem Versuch, seinen Willen zu tun.
Arnold Glitsch-Hünnefeld