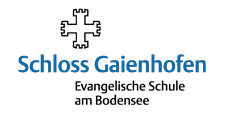Die 10b hat das Abendmahl in ihre Wirklichkeit geholt. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt der Abendmahlsfeier. Die Zeitebenen vermischen sich. Das Geschehen von vor 2000 Jahren, das die Bibel überliefert, und die Gegenwart. Irgendwo dazwischen das Bild von Leonardo da Vinci und der Gesang aus dem Frühbarock. Und bei Licht betrachtet verbinden sich schon im biblischen Geschehen zwei Zeitebenen. Jesus und seine Jünger feiern das Passamahl. Sie vergegenwärtigen sich die Nacht des Auszugs des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten. All das schwingt mit in der Feier des Abendmahls. All das bleibt nicht Vergangenheit, sondern wird in der Inszenierung ein Teil der eigenen Wirklichkeit.
In der Inszenierung der 10b steckt ein Stück Zivilisationskritik. In mehrfacher Hinsicht. Da wird zum einen ein Zeitgeist herausgestellt, nach dem jeder letztlich mit sich selbst beschäftigt ist, in dem Kommunikation allenfalls an der Oberfläche bleibt und durch den Berge von Müll produziert werden. Der Aspekt des Teilens, der im Brotbrechen Jesu anklingt, wird ignoriert. Alles, was die gedankenlose Feier stört, wird verdrängt.
Damit wird letztlich Jesus selbst aus dem Geschehen verdrängt. Niemand von den 12en spricht mit ihm. Er könnte genauso gut fehlen. In einer zweiten Inszenierung bleibt der Platz Jesu tatsächlich leer.
Mir stellt sich die Frage, ob das nur für den oberflächlichen Zeitgeist gilt. Möglicherweise wird Jesus auch aus dem Geschehen gedrängt, wenn überlieferte Rituale wie das Abendmahl nur noch routinemäßig vollzogen werden. Wenn die geschilderte Vergegenwärtigung eben nicht mehr stattfindet. Wenn Jesus zur Leerstelle wird, kann sich jeder seinen eigenen Jesus basteln, wie er ihm gerade gefällt. Man kann ihn zum netten Kuschelhippie zurechtschleifen, der niemandem mehr unbequem wird. Jesus war aber unbequem. Und sich in seinen Wirkungskreis zu begeben, sich mit seinen Jünger*innen zu identifizieren, kann bedeuten, auch mal anzuecken.
Das ist für mich in der Darstellung der 10b auch mit der weiblichen Besetzung der Figur von Jesus ausgedrückt. Diese irritiert erstmal und das ist von der 10b auch so gewollt. Es macht zugleich deutlich, dass Jesus Konventionen und Rollenmuster seiner Zeit unterlaufen hat. Auch im Blick auf das Verhältnis von Mann und Frau. In der Geschichte von Maria und Martha z.B. schickt er Maria nicht an den Herd, sondern bestärkt sie darin, dass sie in der Runde bei all den Männern sitzen bleibt.
Jesus wird aus dem Geschehen herausgedrängt. Er wirkt isoliert. Nicht nur in der Darstellung der 10b, sondern schon im Bild von Leonardo da Vinci. Meine Vorstellung vom letzten Abendmahl, damals am Vorabend der Kreuzigung Jesu, ist eine andere. Für mich ist es ein letzter Moment der Nähe. Noch einmal sind die 12 und Jesus beisammen und unter sich. Noch einmal wird die Gemeinschaft spürbar, die sie über die letzten Monate hinweg miteinander verbunden hat. Alle sind miteingeschlossen. Auch Judas, der Jesus wenige Stunden später verraten wird. Im Bild sitzt er nahe bei Jesus und doch abseits. In beiden Darstellungen wirkt auch er isoliert.
Das ist die andere Seite des Abendmahls. Erste Risse in der Gemeinschaft werden sichtbar. Jesus bezeichnet den Verräter und kündigt Petrus an, dass der ihn verleugnen wird. „Das Brot – mein Leib; der Wein – mein Blut“. Jesus kündigt – einmal mehr – sein Leiden und Sterben an. Die kommenden Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Ob die Jünger das begriffen haben?
Die beiden Darstellungen betonen diesen Aspekt. Kurz darauf wird Jesus wirklich allein und verlassen sein. „Meine Seele ist betrübt bis an den Tod“ wird er im Garten Gethsemane zu seinen Jüngern sagen und sie bitten, mit ihm zu wachen. Doch die Jünger schlafen alle ein. Als er gefangengenommen wird, fliehen sie. Und Petrus, der sich für seinen treuesten Anhänger hielt, wird dreimal behaupten, Jesus nicht zu kennen. Schließlich am Kreuz schreit Jesus „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen“.
Verlassen und allein. Ein schlimmes Gefühl. Viele von Euch werden es kennen und fürchten. Manchmal ist die Einsamkeit von außen erkennbar. Manchmal auch nicht. Manche von Euch funktionieren und wirken nach außen hin fröhlich, auch wenn es in ihnen ganz anders aussieht. Und manche wünschen sich einen Freund oder eine Freundin und finden doch keinen Anschluss. Sie wissen nicht, wie sie Kontakt knüpfen sollen, oder sie trauen sich nicht. Einsamkeit ist auch ein Teil der Passion Jesu.
Doch die Geschichte Jesu endet nicht mit der Nacht der Verlassenheit. Auf den Karfreitag folgt Ostern. Gott lässt nicht zu, dass Jesus aus der Welt gedrängt wird. Die Evangelien erzählen, dass Jesus nach seiner Auferstehung mehrfach seinen Jünger*innen begegnet. Und diese Begegnungen stiften erneut Gemeinschaft.
Von zwei Jüngern wird erzählt, die nach Jesu Tod enttäuscht und niedergeschlagen die Gemeinschaft der Jünger*innen verlassen. Sie machen sich auf den Weg in ihr Heimatdorf Emmaus. Unterwegs begegnet ihnen der auferstandene Jesus und geht mit ihnen. Aber die erkennen ihn nicht. Erst als er ihnen beim Abendessen das Brot bricht, werden ihnen die Augen geöffnet. Jesu Geste vergegenwärtigt ihnen das gemeinsame Abendmahl am Vorabend der Kreuzigung. Das Brotbrechen – in der Darstellung der 10b von den Jünger*innen ignoriert – bekommt zentrale Bedeutung. Die beiden Jünger lassen alles stehen und liegen und eilen zurück zu den anderen, zurück in die Gemeinschaft. Neue Menschen werden in die Gemeinschaft aufgenommen. Zuerst Matthias, dann wachsen erste Gemeinden heran.
Auferstehung bedeutet: Das Geschehen, das mit Jesus begonnen hat, breitet sich aus – über die Grenzen von Israel hinaus und durch die Zeiten hindurch. Auferstehung vergegenwärtigt sich auch in unserer Gegenwart. Da wo Menschen – so wie die 10b – erkennen, dass Gemeinschaft mehr ist, als am selben Ort je um sich selbst zu kreisen. Da wo Menschen einander wirklich sehen und auch hinter die Fassade schauen. Da wo Menschen Anschluss in der Gemeinschaft und wahre Freund*innen finden. Auferstehung bedeutet, dass Menschen sich gerade auch von den unbequemen Seiten Jesu inspirieren lassen. Von seiner Botschaft des Teilens, der Gerechtigkeit und der Nächsten- und Fremdenliebe. Auferstehung bedeutet, dass das Dunkel, auch das Dunkel unserer Zeit, nicht das letzte Wort hat, sondern dass Gott seine Zukunft für uns bereithält.
Amen
Arnold Glitsch-Hünnefeld