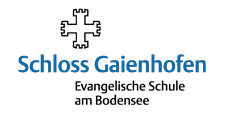Darf‘s ein bisschen politisch sein?
Mittwochsandacht_online

Tim Reckmann / pixelio.de
In der Andacht am vergangenen Mittwoch habe ich mich nicht zum Ausgang der Europawahl am Wochenende zuvor geäußert. Manche haben das vielleicht vermisst. Andere waren vielleicht ganz froh darüber. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, Gedanken zu einem ganz anderen Thema zu formulieren.
Das hatte zum einen inhaltliche Gründe. Dass mich der Rechtsruck in Europa sehr beunruhigt, wird wohl niemanden überraschen und brauchte deshalb wohl kaum noch einmal erwähnt zu werden. Für eine Analyse der Hintergründe dieser Entwicklung böte eine Andacht zu wenig Raum und wäre wohl auch nicht der richtige Ort. Der zweite Grund, warum ich die Europawahl nicht zum Thema gemacht habe, ist, dass ich nicht will, dass die Andacht zu einem politischen Kommentarformat verkommt.
Dieser Grund berührt eine Grundsatzfrage. Die nach dem Verhältnis von Kirche und Politik. Manche Menschen fragen: „Soll sich Kirche nicht besser ganz aus der Politik raushalten? Ist der Glaube nicht Privatsache?“
Meine Antwort auf die zweite Frage ist ein klares „Jein“. „Ja“: Der Glaube ist etwas Persönliches. Etwas zwischen mir und Gott. Glaubensfreiheit ist ein Grundrecht. Und „Nein“: Glaube zielt auf Gemeinschaft. Kirche ist die Gemeinschaft der Gläubigen. In der Kirche findet Verständigung über den Glauben statt und wird der Glaube gemeinschaftlich gefeiert. Gottesdienste sind öffentliche Veranstaltungen. Insofern ist Kirche auch ein wahrnehmbarer Faktor des öffentlichen Lebens, eine gesellschaftlich relevante Größe. Deshalb ist Kirche schon politisch, bevor sie sich in irgendeiner Form politisch äußert oder positioniert. Wo sie schweigt, bestätigt sie das politisch Gegebene.
Klar ist in meinen Augen: Die Kirche kann kein „Wächteramt“ mehr für sich in Anspruch nehmen. Sie kann nicht die Autorität beanspruchen, den Menschen und der Gesellschaft vorzuschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben. Rückblickend kann man fragen, ob sie diesen Anspruch jemals zu Recht erhoben hat oder ob er nicht immer schon eine Form menschlicher Selbstüberhebung war. Heute, wo die Kirchen selbst ihre Glaubwürdigkeit durch den Umgang mit den Missbrauchsfällen in ihren Reihen schwer beschädigt haben und wo sie auf dem Weg sind Minderheitenkirchen zu werden, steht ihnen diese Position erst recht nicht zu.
Aber: Gläubige Christen tragen eine Verantwortung. Der Glaube will im Leben wirksam werden. Und die Kirchen sind gefordert, zu dem zu stehen, wofür sie stehen. Der systematische Theologe Georg Essen fordert eine neue politische Theologie. Zugleich formuliert er ein wesentliches Kriterium dafür: „Es braucht den Bezug zu den Glaubensinhalten, weil jede gesellschaftliche Präsenz ein Ausdruck gläubiger Praxis zu sein hat, in der die Einheit von Gottes- und Nächstenliebe zur Darstellung gelangt.“ Anders gesagt: Kirche soll sich nicht zu jedem beliebigen politischen Thema äußern, sondern nur dazu, wozu sie von ihrem Glauben her etwas zu sagen hat. Bei diesen Themen ist sie dann aber auch gefordert, Stellung zu beziehen.
Zu diesen Themen gehört zum Beispiel die Achtung der Würde jedes Menschen als Ebenbild Gottes. Ausgrenzung und Diskriminierung dürfen Christen nicht dulden. Als Anhänger eines Glaubens, der im Judentum verwurzelt ist, können Christen zu Antisemitismus erst recht nicht schweigen. Die Forderung nach Gerechtigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch beide Teile der Bibel. Die angeschlagene soziale Gerechtigkeit im Land und die weltweite krasse Ungerechtigkeit können Christen nicht gleichgültig sein. Auch das Eintreten für Frieden und die Bewahrung der Schöpfung gehören zu den Kernanliegen des christlichen Glaubens. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Deutlich dürfte sein: Alle diese Themen haben eine politische Dimension und machen es erforderlich, auch politisch Haltung zu zeigen und Position zu beziehen.
Kirche kann also zu bestimmten gesellschaftlichen Themen nicht schweigen. Entscheidend ist allerdings, in welcher Haltung sie sich zu den Fragen äußert, die die Menschen und die Gesellschaft umtreiben. Ich würde sagen: Nicht von oben herab, sondern die Kirche stellt ihre Standpunkte zur Diskussion und verantwortet sie. Nicht dogmatisch, aber klar in der Sache. Theologisch verantwortet und biblisch belegt.
Schließlich: Kirche, das sind die Menschen, aus denen sie sich zusammensetzt. Die einzelnen Gläubigen sind gefragt, für das einzustehen, woran sie glauben. Die dazu nötige Urteilsfähigkeit ist ein zentrales Anliegen des Religionsunterrichts. Eine Säule des Bildungsplans heißt „Welt und Verantwortung“. Christen beten und träumen sich nicht aus der Welt, sondern leben ihren Glauben in der Welt. Deswegen ist nicht nur von der Kirche als Organisation und von hauptamtlichen Repräsentanten wie mir Haltung gefragt, sondern von uns und Euch allen. Deshalb ist es richtig und Teil unseres christlichen Profils, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, Schule ohne Rassismus und Schule mit Courage zu werden.
Ich wünsche mir an unserer Schule und in unseren Kirchen eine offene Diskussionskultur, keine faulen Kompromisse und den Mut zu einer aufrechten Haltung.
Arnold Glitsch-Hünnefeld