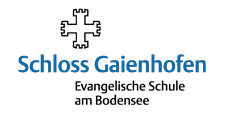„Memento“
Mittwochsandacht_online

Vielleicht sind Euch die acht Bilder an der Wand aufgefallen, als Ihr in die Kirche gekommen seid. Es sind Bilder der vor nicht allzu langer Zeit verstorbenen Künstlerin Waltraud Jacob. Sie hat unter anderen in Kattenhorn und in Radolfzell gelebt. Die Bilder gehören zusammen und bilden einen Zyklus mit dem Titel „Memento“. Übersetzt heißt das „Erinnere dich“ oder „Gedenke“. Die Ausstellung der Bilder in unserer Kirche läuft von heute bis zum 23.11. dem Toten- oder Ewigkeitssonntag. „Memento“ – um das Erinnern geht es in dem Bilderzyklus auf vielfältige Weise und auch in der Andacht heute.
Für die Bilder hat Waltraud Jacob alte, von Menschen getragene Hemden gesammelt. Die ursprünglich weißen Hemden hat sie mit erdfarbenen Pigmenten versehen und auf Leinwände aufgebracht. Die erdbraune Farbe steht für Gebrauch, für das Vergilben von Farbe, für die Vergänglichkeit. Zugleich stehen die Hemden für die Menschen, die sie getragen haben, und für ihre Leben. Hemden sind Kleidungsstücke. Sie werden auf dem Körper getragen, manchmal – wenn kein Unterhemd darunter ist – direkt auf der Haut. Sie sind den Menschen ganz nah. Hemden können ganz verschiedene Funktionen haben – vom Arbeitskittel bis zum edlen Festtagshemd. Hemden sind oft auch Ausdruck des Geschmacks und der Individualität derer, die sie tragen. Hemden begleiten Menschen von der Wiege bis zur Bahre – vom Taufkleid am Anfang des Lebens bis zum Totenhemd. Die Hemden auf den Bildern erinnern an Menschen – Memento.
Indem der Witwer von Waltraud Jacob uns diese Bilder für die Ausstellung zur Verfügung gestellt hat, erinnert er zugleich an einen bestimmten Menschen – an seine verstorbene Frau. Im Sommer war ihr schon eine Ausstellung im Fischerhaus in Wangen gewidmet mit dem Titel „In Memoriam“ – In Erinnerung.
Vor 14 Jahren waren diese Bilder schon einmal unter dem Titel „Memento“ ausgestellt – in der ehemaligen Synagoge in Kippenheim. Diese Ausstellung hatte zwei Teile. Auf dem Boden hatte die Künstlerin eine Spirale gelegt, die an das Leben eines Mannes erinnerte, der als Halbjude von den Nazis verfolgt worden war und überlebt hatte. Diese Spirale stand für den Sieg des Lebens. In dieser Ausstellung bildeten die acht Bilder den Kontrast und standen für Leid und Tod. Für die unzähligen Juden, die die Verfolgung durch die Nazis nicht überlebt hatten.
Für sich genommen hier in der Kirche erinnern die Hemden an beide Seiten: An die Vergänglichkeit – „memento mori“ – und an das Leiden der Ermordeten. Aber auch an das Leben, mit dem ihre Träger*innen die Hemden gefüllt haben. An ihren Alltag und an die glücklichen Momente. Auf der Hälfte der Bilder sind jeweils zwei Hemden angebracht. Menschen, die Momente im Leben geteilt haben. Die vielleicht gemeinsame Erinnerungen hatten.
Die Verbindung zwischen dem Bilderzyklus „Memento“ und jüdischen Schicksalen ist kein Zufall. Spätestens durch die Ausstellung in der Synagoge hat die Künstlerin den Bildern diese Bedeutung gegeben. Die Verbindung zum Judentum geht aber noch weiter. Das Erinnern spielt im Judentum eine besonders wichtige Rolle.
Am Pessachfest erinnern sich Juden an die Nacht des Auszugs aus Ägypten. Sie stellen die Situation im Sedermahl nach. Den eiligen Aufbruch, der nicht zuließ, dass man den Teig für die Brote durchsäuern ließ. Und schon in der Erzählung dieser Nacht wird zum Erinnern aufgefordert: „Wenn dein Kind dich morgen fragen wird ‚Was bedeutet das?‘, sollst du ihm sagen: Der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten, aus der Sklaverei geführt.“ Jedes Jahr beim Pessachfest fragt ein Kind nach der Bedeutung des Festes und bekommt diese Erinnerung als Antwort.
Im Pessachfest wird die Vergangenheit zur Gegenwart, sie wird ver-gegenwärtigt. Das ist eine wichtige Funktion des Erinnerns. Dabei geht es nicht darum, in der Vergangenheit stecken zu bleiben, sondern darum, sich seiner Identität zu vergewissern und für die Gegenwart zu lernen. Für die Juden gilt: Wir sind das Volk, das Gott befreit hat.
Christen haben diese Kunst des Erinnerns, diese Kunst des Vergegenwärtigens von den Juden übernommen. Zum Beispiel beim Abendmahl, bei dem das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern vergegenwärtigt wird. Das war übrigens ein Pessachmahl.
Wichtige Momente der Vergangenheit lebendig halten, das ist für uns Menschen wichtig. Bilder, Geschichten, Feiern und anderes mehr können dabei helfen. Die Ereignisse werden auf eine andere Art lebendig und gegenwärtig als durch die reine Überlieferung der Fakten. Im Erinnern des Schönen und des Schlimmen führen wir uns vor Augen, woher wir kommen, wer wir sind und was wir daraus lernen können. Was die Vergangenheit für unsere Gegenwart bedeutet.
In diesen Wochen sind Erinnerungen an eine schlimme Zeit in Deutschland gegenwärtig. Am 22. Oktober 1940 wurden fast alle Juden aus Baden in das Konzentrationslager Gurs in Frankreich verschleppt. Manche starben auf dem Weg dorthin, manche in Gurs, manche in anderen KZ’s, in die sie weiter verschleppt wurden. Am 9. November 1938 wurden in ganz Deutschland jüdische Geschäfte verwüstet und brannten Synagogen – die sogenannte Reichskristallnacht.
Schüler*innen unserer Schule erinnern auf zweifache Weise daran, dass Jüdinnen und Juden hier in unserer Gegend gelebt haben, und daran, was ihnen angetan wurde. Im Foyer der Schule ist eine Ausstellung zu sehen, die an das jüdische Leben in Wangen erinnert. Und am kommenden Sonntag, also am 9. November wird das Mahnmal eingeweiht, das Schüler*innen zum Gedenken an die Juden angefertigt haben, die aus Wangen nach Gurs verschleppt wurden. So bleiben sie gegenwärtig.
Erinnern ist wichtig für die eigene Gegenwart. Wir erinnern an Menschen, die aus der Erinnerung gelöscht werden sollten. Wir vertrauen darauf, dass Menschen sich an uns erinnern werden, wenn wir einmal nicht mehr sind. Das ist ein tröstlicher Gedanke. Und selbst wenn es einmal keine Menschen mehr geben sollte, die sich an uns erinnern, gibt es einen, der unsere Erinnerung wachhält: Gott selbst. Bei ihm sind wir und alle Menschen bewahrt – im Leben und im Tod.
Arnold Glitsch-Hünnefeld